POSITIONEN

INGA HEHN
Papier ist für Inga Hehn Ort und Spielfeld für Lithografien, Marmorierungen und Zeichnungen. Mit Tusche und Feder fordert sie das Sehen heraus, erkundet feinste Strichgefüge. Der Katalog stellt Hehns künstlerische Arbeit vor mit dem Schwerpunkt Zeichnung und Marmorierung, vor allem Blätter aus der "Trichter" und der "Drift" Serie werden gezeigt. die genau aufeinander abgestimmt sind.

FEMALE UTOPIAS
Warum brauchen wir in den Zwanzigerjahren des 21. Jahrhunderts immer noch nicht nur Utopien, sondern auch Frauen- und feministische Utopien? Die philosophische Tradition des Nachdenkens über Utopien, die bis zu Platon und Thomas More zurückreicht, verbindet den Begriff der Utopie mit der Vorstellung einer radikalen Alternative zu einer ungerechten Gesellschaftsordnung. Die Utopie verspricht nicht einfach eine Existenz ohne Ungleichheit und Ausbeutung, sondern schlägt vor, sich eine Harmonisierung verschiedener gesellschaftlicher als auch der Natur nicht entgegengesetzter Verhältnisse vorzustellen.
Autorinnen: Nasta Mancewicz, Evelyn Bernadette Mayr, Marina Naprushkina, Michele Najlis, Olga Shparaga, Marlene Streeruwitz

FEMALE POSITIONS
20 Positionen in Form von Analysen, Erlebnissen, Erfahrungen, Sehnsüchten und Veränderungsansätzen, die das Hier und Jetzt aus weiblicher Sicht abbilden – 20 Blickwinkel zur Verortung von Geschlechtergerechtigkeit. Es gibt noch viel zu tun …
Mit Beiträgen von: Ljuba Arnautovic, ́Daniela Banglmayr, Susanne Baumann, Tanja Brandmayr, Elisabeth Cepek-Neuhauser, Conny Erber, Katja Fischer, Sabine Gebetsroither, Johanna Grubner, Beate Hausbichler, Sandra Hochholzer, Anna Katharina Laggner, Verena Koch, Mari Lang, Barbi Markovíc, Eva Sangiorgi, Claudia Seigmann, Tanja Traxler, Hiroko Ueba, Claudia Wegener
Female Positions wurde zu einem der schönsten Bücher Österreichs 2022 gewählt.
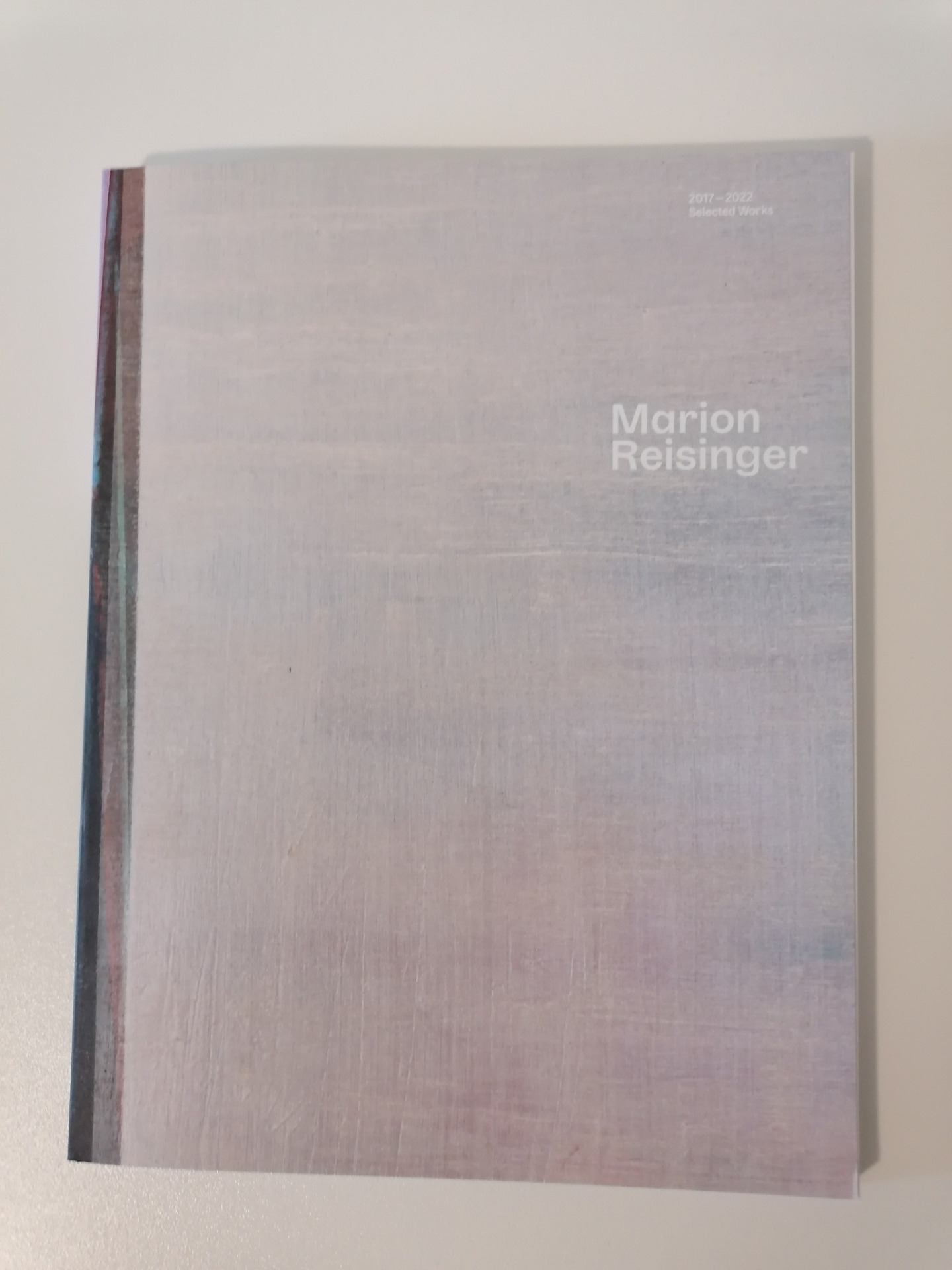
MARION REISINGER
"Wir blicken auf ihre Werke und begegnen mit ihr - als geheimnisvoller Reiseleiterin - den eigenen Fantasien. Marion baut Malerei: Collagen aus Ölfarbe, sperrige Strukturen, körperreiche Schichten, halb transparente Säfte, die durch die Farbebenen fließen."
(Ursula Hübner über Marion Reisinger)